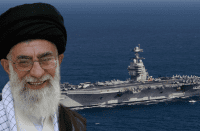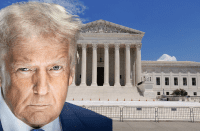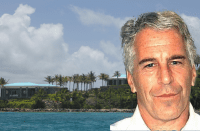Donald Trump will sich den Kryptotrend zunutze machen. Nicht mit eigener Memecoin, sondern indem er Stablecoins an US-Staatsanleihen binden. Dadurch wir der Staatspapierkauf künstlich angekurbelt.

(Bildmontage: Offensiv!; Donald Trump: Daniel Torok, Public domain, via Wikimedia Commons; Tether Logo: Spuspita, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons; USD Coin-Logo: Blockchain, Public domain, via Wikimedia Commons)
Im Gegensatz zu bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin, deren Kurs innerhalb kurzer Zeit um mehrere Tausend Euro schwanken kann, sind Stablecoins an klassische Währungen wie den US-Dollar gekoppelt. Sie sollen dadurch weitgehend wertstabil bleiben. Investoren nutzen sie häufig, um Gewinne zwischenzuparken oder Handelssummen liquide zu halten, ohne den extremen Schwankungen anderer Kryptowerte ausgesetzt zu sein. Bisher war dieser Bereich weitgehend unreguliert, weswegen die US-Regierung unter Trump diesen Markt erstmals unter staatliche Aufsicht stellt.
Gesetz zur Stabilisierung?
Trotz ihres stabilitätsversprechenden Namens kam es in der Vergangenheit wiederholt zum völligen Kollaps einer solchen Währung. Ein besonders prominenter Fall war der Zusammenbruch des algorithmisch gestützten Stablecoins „TerraUSD“, dessen Kurs 2022 infolge der Pleite der Silicon Valley Bank zusammenbrach, da ihm eine verlässliche 1:1-Deckung durch reale Vermögenswerte fehlte. Trumps neues Gesetz soll genau solche Risiken künftig vermeiden: Es verpflichtet Stablecoin-Emittenten dazu, ihre digitalen Dollar vollständig durch US-Dollar oder kurzfristige US-Staatsanleihen zu hinterlegen. Da Dollar keine Rendite erwirtschaften werden sich die meisten Anbieter für die Staatsanleihen entscheiden Darüber hinaus müssen monatliche Prüfberichte vorgelegt und Anti-Geldwäsche-Maßnahmen eingehalten werden.
Oder Cashgrab zur Staatsschuldenfinanzierung?
Ob die neue Regulierung die Anleger schützt, darüber kann man geteilter Meinung sein. Was sie auf jeden Fall tut ist dies: Sie stärkt die Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Das ist zum allermindesten eine willkommene Nebenwirkung für die hochverschuldeten Vereinigten Staaten. Mit einem Schuldenstand von mittlerweile über 36,8 Billionen US-Dollar ist die Refinanzierung über Anleihen essenziell, insbesondere da sich in den vergangenen Jahren immer mehr ausländische Investoren von US-Staatsanleihen abgewendet haben – darunter auch China, das einst der größte Halter weltweit war.
Da Stablecoin-Anbieter ihre digitalen Dollar mit US-Staatsanleihen unterlegen müssen, entsteht ein zusätzlicher, langfristiger Käuferkreis für diese Papiere. So zählte der größte Stablecoin-Emittent Tether im Februar 2025 bereits zu den zwanzig größten Haltern von US-Staatsanleihen und hielt damals Bestände, die beinahe dem Volumen aller deutschen Investoren entsprachen.
Extreme Krisenanfälligkeit
Doch Trumps Ansatz ist nicht ohne Risiken. Die zunehmende Verzahnung der Kryptowelt mit dem traditionellen Finanzsystem – insbesondere mit der US-Staatsverschuldung – könnte neue Schwachstellen schaffen. Gerät das Vertrauen in US-Staatsanleihen beispielsweise durch einen Kurssturz an der Börse ins Wanken, könnten Stablecoins rasch unter Druck geraten, da viele Nutzer ihre Einlagen gleichzeitig abziehen wollen. Eine solche Kettenreaktion könnte in der Folge nicht nur den Kryptosektor, sondern auch weite Teile des Finanzmarktes destabilisieren. Vor allem aber stellt sich die Frage: Darf der Staat durch Finanzmarktregulation Käufer für seine eigenen Anleihen schaffen? Und wenn er dies tut, welche Risiken birgt das?