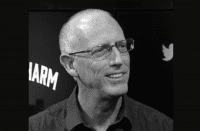Hängt eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Kanada von der Palästina-Frage ab?

(Bildmontage: Offensiv!; Kanadische Flagge: Crisco 1492, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons;Donald Trump: Daniel Torok, Public domain, via Wikimedia Commons)
Donald Trump setzt seine globale Zollpolitik weiterhin mit Nachdruck fort. Während zahlreiche Staaten inzwischen bilaterale Abkommen mit den USA erzielt haben – die Europäische Union dabei wie so oft mit eher ungünstigen Ergebnissen – ist eine Einigung mit Kanada derzeit nicht in Sicht. Hintergrund ist die Ankündigung der kanadischen Regierung, sich bei der kommenden UN-Vollversammlung im September möglichen Resolutionen zur Anerkennung Palästinas als souveräner Staat anzuschließen. Kanada folgt damit dem Kurs Frankreichs und weiterer 14 Staaten, die sich öffentlich für ein unabhängiges Palästina ausgesprochen haben. Für Trump, der als bedingungsloser Unterstützer Israels gilt, ist dies inakzeptabel. Auf seiner Plattform „Truth Social“ machte er deutlich, dass eine Einigung mit Kanada von dessen außenpolitischer Haltung im Nahostkonflikt abhängig sei.
Der Israel-Konflikt als Druckmittel
Anhand dieses Beispiels ist das Zusammenspiel von geopolitischen Konflikten und Handelspolitik sehr gut zu beobachten. Obwohl die Bekundung Kanadas, Palästina als Staat anzuerkennen, sehr wahrscheinlich überhaupt keine Rolle für den Ausgang des Konflikts spielt, wird sie ausgenutzt, um eine bessere Verhandlungsposition im Zollstreit einzunehmen und Druck auf Kanada auszuüben. Es ist damit nicht unerheblich, wie sich Länder zu geopolitischen Konflikten positionieren.
Generell gilt, dass sich jedes Land so positioniert, dass es politisches Kapital daraus schlagen kann. Relativ unbeteiligte Länder können demnach leicht moralische Symbolpolitik betreiben, indem sie unter Berufung auf die Menschenrechte ihre Innen- sowie Außenwirkung verbessern. Länder wie die USA, die in den Konflikt stärker involviert sind, gehen über die Symbolpolitik hinaus. Sie agieren aus einer Position der Stärke heraus, die realpolitischen Einfluss hat. Kanada beispielsweise kann umgekehrt keine derartigen Forderungen stellen, ganz abgesehen von der generell größeren Macht der USA. Kanada hätte also diese öffentliche Haltung zur Palästina-Frage noch hinauszögern können, um diesem Druckmittel zu entgehen.
Außenpolitik à la Trump
Dass die Art und Weise, wie Trump auf politische Angelegenheiten reagiert, ungewöhnlich ist, ist nichts Neues. Ob Beleidigungen anderer Staatschefs oder die öffentliche Androhung kriegerischer Handlungen durch polarisierende Tweets, er bricht damit, vor allem im Umgang mit diplomatischen Verhandlungen, mit gängigen Konventionen. Vertrauliche Gespräche oder Zurückhaltung bei öffentlichen Stellungnahmen sind ihm fremd. Man kann sich bei ihm kaum sicher sein, ob es überhaupt einen geschützten diplomatischen Rahmen gibt. Auf der einen Seite ist das ein mal mehr, mal weniger klar interessengeleitetes Vorgehen, auf der anderen Seite nimmt darunter das diplomatische Verhältnis zu anderen Staaten erheblichen Schaden. Langfristig kann das zu einem Rückgang diplomatischer Beziehungen führen, was gerade bei geopolitischen Großkonflikten nicht besonders förderlich ist.
Mit seiner Vorgehensweise bringt Trump andere oft in eine schwierige Lage. Durch sofortige Tweets bleibt anderen Staatschefs weniger Raum, gesichtswahrend aus Verhandlungen auszusteigen. Trump kann damit vor offiziellen Pressemitteilungen den Frame setzen. Jetzt könnte man sagen, dass die anderen Staatschefs es ihm gleich machen könnten. Problem: Es entspricht überhaupt nicht ihrem Politikerprofil, sodass es unglaubwürdig und unseriös wirken würde. Dieses öffentlichkeitswirksame Verhalten kann, gut eingesetzt, von Vorteil sein. Andererseits ist dieses teils affektgesteuerte Handeln gefährlich und sorgt für Unsicherheiten – nicht nur bei anderen Staaten, sondern auch bei seinen eigenen Unterstützern.
Trump mischt das diplomatische Feld auf. Geht seine Strategie auf, profitiert er. Geht sie schief, müssen andere aufräumen. Am besten hilft gegen „Trumpsche Figuren“ vor allem die Stärkung der eigenen Position. Angelehnt an die Grundannahmen des klassischen Realismus haben wir Europäer hier dringenden Nachholbedarf, was der letzte „Deal“ ohne Zweifel bestätigt.