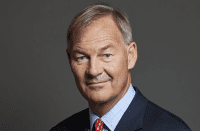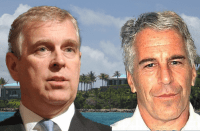Portugals Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Luís Montenegro erhält mit Unterstützung der rechtspopulistischen Chega eine Mehrheit für eine Reform der Einwanderungspolitik. Im Fokus stehen vor allem der Familiennachzug und die Vergabe von Visa.

(Bildmontage: Offensiv!: Castelo de Guimarães: António Amen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons; Portugiesische Flagge: Columbano Bordalo Pinheiro, Public domain, via Wikimedia Commons)
Nach Jahren einer radikal offenen Migrationspolitik kündigt sich nun ein Kurswechsel an. Die Bürger Portugals dürfen sich auf eine Politikerkaste freuen, die sich – man staune – tatsächlich an einer Begrenzung der Einwanderung versucht. Zumindest deutet die neue Reform in diese Richtung. Doch der erste Wermutstropfen lässt nicht lange auf sich warten: Was wäre eine Reform in unserem parlamentarischen Betrieb, die nicht direkt aufgrund juristischer Einwände auf Eis gelegt würde? Die Bürokraten wollen sich absichern – verständlich. Warum nicht gleich ein Gesamtpaket zur Abstimmung bringen, das rechtliche Zweifel mit klärt? Unvorstellbar. Am Ende wurde der Familiennachzug verschärft und die Vergabe von Visa nur noch für hochqualifizierte Einwanderung gestattet. Der ebenfalls angedachte Eingriff ins Staatsbürgerschaftsrecht wurde vorerst vertagt. Eben aus juristischer Unsicherheit, versteht sich.
Wie es dazu kam: Eine zwangsläufige Symbolpolitik
Die politischen Systeme des Westens folgen einer vertrauten Logik: Sie handeln nicht vorausschauend, sondern erst dann, wenn die Realität sie dazu zwingt. Portugal macht da keine Ausnahme. Die jüngste Reform war kein mutiger Schritt, sondern das vorhersehbare Ergebnis jahrelang aufgestauten gesellschaftlichen Drucks. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die Dysfunktion mancher Integrationsstrukturen und das wachsende Misstrauen gegenüber staatlicher Steuerungsfähigkeit führten zu einem Punkt, an dem symbolisches Handeln unvermeidlich wurde.
Die Reform war keine Überraschung. Sie war ein Reflex. Kein strategischer Umbau, sondern ein politisches Signal: „Wir haben verstanden.“ Doch was wurde wirklich verstanden? Und wie ernst ist dieser Richtungswechsel gemeint?
Tatsächlich bleibt der Charakter dieser Reform vor allem eines: symbolisch. Der Apparat hat sich bewegt, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil er musste. Diese Art von Bewegung ist typisch: oberflächlich, risikolos, so gestaltet, dass sie maximalen Eindruck bei minimalem Aufwand hinterlässt.
Die eigentliche Frage lautet daher nicht mehr, ob Reformen kommen, sie kommen zwangsläufig. Sondern: Wer versteht es, daraus politisches Kapital zu schlagen? Kann eine Partei wie die AfD glaubhaft vermitteln, dass solche symbolischen Korrekturen nicht reichen und dabei zugleich Druck aufrechterhalten? Oder reiht sie sich am Ende doch in jene ein, die jede noch so zaghafte Maßnahme als Erfolg verbuchen und damit das System stabilisieren, das sie eigentlich herausfordern will?
Portugal und Deutschland – ein Vergleich mit Aussicht
Portugal könnte ein Vorgeschmack auf Deutschlands politische Realität im Jahr 2029 sein: ein linker Block aus Grünen, SPD und Linken – die AfD in der Opposition (was nicht das Schlechteste wäre) – und die CDU/CSU als wankender Ordnungsfaktor zwischen den Lagern. Die sogenannte Brandmauer wird fallen – die Frage ist nicht ob, sondern wie.
Entscheidend wird sein, wie die AfD damit umgeht. Die CDU könnte aus der Konstellation profitieren, indem sie die AfD klein hält und als Mehrheitsbeschaffer instrumentalisiert. Umso wichtiger ist es, dass die AfD nicht bloß numerisch erstarkt, sondern weltanschaulich fest verankert ist.
Wie gut sie in dieser Hinsicht aktuell aufgestellt ist, möge jeder selbst beurteilen. Den Portugiesen jedenfalls kann man nur wünschen, dass sie ihre innenpolitischen Herausforderungen in den Griff bekomme und nicht erneut in Richtung der utopistischen Sozialisten abdriften.
Was bedeutet das für das Ziel der Remigration?
Mit der Abkehr von offenen Grenzen ist in Portugal eine entscheidende Hürde gefallen. Die geistige Blockade ist durchbrochen. Jetzt geht es nicht mehr um das Was, sondern um das Wie.
Das ist im Grunde der Rechtsruck der europäischen Eliten, von dem viele schwadronieren: das stille Eingeständnis, dass Steuerung notwendig ist, aber ohne zu benennen, wie weit sie gehen darf.
Dem liegt eine Hoffnung zugrunde, die trügerisch sein könnte: dass ein parteipolitischer Richtungswechsel automatisch eine strukturelle Kehrtwende bewirken kann. Doch parteipolitisch lässt sich allenfalls eine Schadensbegrenzung erreichen für eine tatsächliche 180-Grad-Wende müssten die europäischen Eliten beispielsweise in der Abkehr von diversen Konventionen einen eigenen strategischen Vorteil erkennen. Hierfür muss man ja nicht einmal gleich austreten. Eine andere Auslegung dieser netten und abstrakten Rechtskonstrukte würde schon reichen.
Ein solcher Vorteil ist bislang nicht sichtbar und genau darin liegt das zentrale Hindernis.