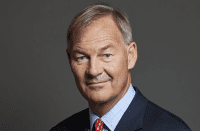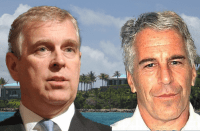Ein Bericht der NGO EU DisinfoLab warnt vor angeblicher Klimadesinformation in Europa. Doch Kritiker sehen in der Analyse weniger den Schutz demokratischer Prozesse als den Versuch, legitime politische Debatten zu delegitimieren – zugunsten eines zunehmend autoritär auftretenden Klimakonsenses.

(Bild: Midjourney)
Mit dem Bericht „HEAT: Harmful Environmental Agendas & Tactics“ legt die in Brüssel ansässige Organisation EU DisinfoLab eine umfassende Analyse zur sogenannten Klimadesinformation in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden vor. Gefördert vom European Media and Information Fund – mitverantwortet von EU-nahen Akteuren wie der European University Institute – sieht sich der Bericht als Beitrag zur Verteidigung von Wissenschaft und Demokratie. Doch während er nach eigenen Angaben gefährliche Falschinformationen entlarvt, wirft er zugleich zentrale Fragen zur Meinungsfreiheit, politischen Fairness und Pluralität auf.
Vier Feindbilder des neuen Klimakonsenses
Der Bericht arbeitet mit einem klaren Raster: Er identifiziert vier Hauptbereiche, in denen angebliche Desinformation verortet wird. Dazu zählen sogenannte „Verschwörungsmilieus“, „Kulturkriege“, „feindliche staatliche Akteure“ und „kampagnenartige Narrative mit Bezug zur fossilen Industrie“.
Verschwörungsmilieus: Themen wie Geoengineering oder HAARP gelten als besonders gefährlich, da sie institutionelles Vertrauen untergraben sollen.
Kulturkämpfe: Auffälligerweise gelten auch Narrative als problematisch, die Klimapolitik als elitär, übergriffig oder autoritär beschreiben – also genau jene Kritik, die in der öffentlichen Debatte vielerorts formuliert wird.
Staatliche Akteure: Russlandnahe Medien (oder zumindest die als solche interpretiert werden) und Telegram-Kanäle werden als strategische Verstärker von Desinformation genannt.
Ölindustrie-Nähe: Zwar fehlen konkrete Belege für gezielte Kampagnen großer Konzerne, doch allein die ideologische Nähe mancher Narrative zu wirtschaftlichen Interessen reicht offenbar zur Brandmarkung.
Auffällig ist: Direkte wissenschaftliche Leugnung sei rückläufig – problematisch sei inzwischen bereits jede kritische Rahmung von Klimapolitik, so der Tenor des Berichts.
Kritik an Klimapolitik – bald strafbar?
Besorgniserregend sind vor allem die politischen Folgerungen. So fordert der Bericht, die identifizierten Narrative als „systemisches Risiko“ im Sinne des Digital Services Act (DSA) zu behandeln. Plattformen wie Facebook, X oder Telegram müssten demnach stärker in die Pflicht genommen werden, entsprechende Inhalte zu identifizieren und zu moderieren – ein Euphemismus für Löschung oder algorithmische Unterdrückung.
Doch was genau fällt unter „Desinformation“? Der Bericht nennt etwa Aussagen, wonach das Heizungsgesetz in Deutschland Privathaushalte und Industrie gefährde. In den Niederlanden wird die Erzählung, der Stickstoffkonflikt sei ein Vehikel zur Enteignung von Landwirten, ebenfalls als Desinformation gewertet. Und in Frankreich gilt die Kritik an Zonen mit niedrigen Emissionen und „15-Minuten-Städten“ als Teil einer gefährlichen Klimaskepsis.
Dabei sind all diese Themen Gegenstand realer, gesellschaftlich breit verankerter Diskussionen – oft getragen von Betroffenen, nicht von „Trollen“ oder „Agenten Moskaus“.
Die Grauzonen der Wissenschaft – und der Zensur
Ein weiterer blinder Fleck des Berichts: Die existierende wissenschaftliche Debatte. Es gibt renommierte Forscher, die etwa die Dramatik der Klimaprognosen hinterfragen, technologische Alternativen betonen oder staatliche Interventionen kritisch bewerten – ohne im Geringsten „Desinformation“ zu betreiben. Doch diese Unterscheidung bleibt im Bericht weitgehend aus. Stattdessen wird Kritik systematisch pathologisiert – als ideologisch, manipulativ oder „extern gesteuert“.
Zugleich ist die Methodik des Berichts intransparent. Die Daten stammen u. a. von der Analysefirma Logically, deren proprietäre Tools nicht offengelegt werden. Die Auswahl der untersuchten Plattformen – vorwiegend X, Facebook und Telegram – könnte überdies zu einer verzerrten Darstellung führen, da dort polarisierte Narrative naturgemäß präsenter sind.
Demokratischer Diskurs unter Verdacht
Der Ton des Berichts erinnert an eine neue Form digitaler Orthodoxie. Kritik an grüner Politik wird nicht mehr als legitimer Ausdruck bürgerlicher Sorge betrachtet, sondern als Teil eines orchestrierten Angriffs auf die Demokratie. Dass viele der sogenannten Desinformationsnarrative längst in seriösen Medien und politischen Gremien diskutiert werden, scheint dabei zweitrangig.
Wer sich dem Konsens nicht anschließt, steht schnell im Verdacht, fremdgesteuert oder extremistisch zu sein. Die Folge: Eine politisch gewollte Verengung des Meinungskorridors – legitimiert durch die Rhetorik von Wissenschaft, Sicherheit und Verantwortung.
Zwischen Schutz und Kontrolle
Wer die Demokratie schützen will, darf die offene Auseinandersetzung nicht einschränken. Die Grenze zwischen Desinformation und Dissens ist schmal – und gerade deshalb muss sie mit größter Sorgfalt gezogen werden. Andernfalls droht der berechtigte Kampf gegen Fake News selbst zu einem Instrument der politischen Kontrolle zu werden.